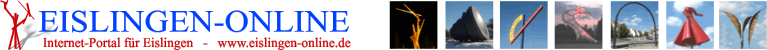|
'Auf schmalem Grat':Nathalie Grenzhäuser stellt beim Kunstverein aus
Viel Publikum bei der Vernissage, Gerhard van der Grinten redet (siehe Anhang)
23.1.2010 - Peter Ritz
'Der schmale Grad', der Titel der Ausstellung, war Ausgangspunkt einer sprachlich ausgefeilten, launischen Einführungsrede Gerhard van der Grintens, die den Bogen schlug von der Wahrnehmung der Subjekte bis hin zu Caspar David Friedrich und dem zerstörerischen Wirken des Menschen.
Suchbilder: Wieviele BM-Kandidat(inn)en waren da?
Die Vernissagerede von
Gerhard van der Grinten
SINFONIA ARCTICA
Für Nathalie Grenzhaeuser
And stopped at once amid their maddest plunge!
Motionless torrents! Silent cataracts!
Coleridge
Auf dem schmalen Grat zwischen Vergangenheit und Zukunft liegt die Gegenwart. Was vor ihr gewesen war, ist nicht. Und was werden wird, ist ebenso wenig. Und tritt es ein, ist das was ist, gewesen und nicht mehr. Und dennoch lässt sich Augustinus’ schönes Paradox der Zeit aushebeln durch die Kunst. Denn die vermag Bilder sichtbar zu machen, von Dingen, die, während ihre Abbilder weiterexistieren, längst vergangen sind. Ja sie kann sogar Bilder einer Zukunft schaffen, die zumindest glaubhafte sind, vielleicht wahrscheinliche. Und dann waren sie, bevor etwas eingetroffen ist, schon da. Das Bild lässt die Zeit stillstehen, ja es kann ihr Stille geben. Zumindest für die Zeit seiner eigenen Existens.
Macht das Abbild sichtbar, so verschleiert es doch auch. Denn wenn es dem Unsichtbaren oder Ungreifbaren Gestalt gibt, verändert es das Sichtbare seinerseits. Und kann es zum Verschwinden bringen. Nehmen wir selbst doch längst nicht alles wahr, was wir sehen. Sondern wählen aus. Oder besser gesagt, unser Gehirn trifft Vorauswahl, was uns dienlich, was hindert, was es aus unserem Sehen beiseite lässt, auf dass es nicht stört. Und richten wir den Blick in Sekundenbruchteilen von einem nahen auf einen weiter entfernten Gegenstand, so gaukelt es uns einen bruchlosen Übergang vor, interpoliert aus all den Sehfragmenten der Augenblicke zuvor, die es nicht verwendet, wohl aber gespeichert hat. Wir haben uns in unserer Wirklichkeit häuslich niedergelassen. Doch ist sie nur scheinbar wirklich und nicht weniger Innenwelt.
Trau nicht dem, was Du siehst. Landschaft beispielsweise, uns doch so gewohnt, ist nicht Natur. Natur west. Und das tut sie ohne aesthetischen Plan. Sondern allein nach den ihr innewohnenden Maßgaben und Kräften. Und jenen Umständen, denen sie ausgesetzt ist. Unaufhörlichen von Einstrahlung und Wind, Niederschlag und Witterung, Aufwuchs, Blüte und Vergehen. Und solchen inwendigen, die teils in ungeheuren Intervallen geschehen, dass wir sie bestenfalls in ihren Sedimenten, viel seltener in ihren Eruptionen zu spüren bekommen. Das aber braucht den Menschen nicht, da ist er, sagen wir es milde, vielleicht geduldet, wie wir Rädertierchen dulden. Weniger freundlich gesprochen wäre er ein Betriebsunfall, vor allem in dem, was er als Hinterlassenschaft verursacht. Hat die Menschheit doch den fatalen Hang, die Welt zur Halde ihrer Unachtsamkeit zu machen. Nachdrücklich, zerstörerischer, wo nichts überwachsen kann, und Wind und Sand und Eis Äonen brauchen, um die Spuren auszulöschen.
Selbst da, wo gewiss kein kreativer Wille waltet, gestaltet der Mensch, wo immer er hingekommen ist, im besten Sinne, wie im ärgsten. Denn Landschaft ist geformt, ist auch Kultivierung. Und sie ist dem Menschen während seiner Entwicklungsgeschichte in dem Augenblick bewusst geworden, als etwas anderes, etwas ihm Entgegnendes, als er selbst nicht mehr als nomadisierender Teil ihrer Weite blieb, sondern sesshaft wurde: tatsächlich findet sich die früheste bekannte, achteinhalb Jahrtausende alte Darstellung einer Landschaft in einer der ältesten Stadtsiedlungen der Menschheit, in Čatal Hüyük in Anatolien: sie zeigt die Stadt selbst und die Landschaft im Hintergrund – als nun geschiedene Welten.
Landschaft ist eben auch das Bild, was man sich von ihr macht. Auch das klingt paradox, denn schließlich ist die abgebildete Welt auch ohne uns vorhanden. Und dennoch ist sie erst im Blick des Betrachters, des Malers, des Photographen Gestalt geworden. In der Wahl von Bildausschnitt, Standort, Perspektive, Tiefenschärfe, nicht zuletzt der aufgenommenen Bildelemente. Denn selbst das, was sich dokumentarisch gibt, wählt aus. Gestalt zeigt sich im Sinn, den sie dem Betrachter offenbart. Oder den er hineinlegt. Denn wir alle sind durch unsere Wahrnehmung konditioniert, in dem, was sich uns zeigt, Erkennbares, ja eben doch auch Wiedererkennbares zu suchen und zu finden. Anderwärts wir von den visuellen Eindrücken, die in jedem Augenblick auf uns einstürzten, völlig überfordert, vollkommen überwältigt wären. Und unfähig, ihnen mit unserem Verstande beizukommen.
Natürlich ist da auch das Schwelgen: gerade in dem, was uns als zum ersten Mal zu begegnen scheint, die fremden Welten, in denen noch nie ein Mensch zuvor gewesen ist, die ihn erfüllen mit Neugier nicht weniger als mit Ängstlichkeiten. Das spürt man Dürers aberwitzig naturgetreuen Landschaftsaquarellen ebenso noch an, wie den Subtropenmalereien der Pioniere Frans Post und William Hodges, oder der geradezu kulinarischen Grandeur, mit der die Generation der amerikanischen Maler um Bierstadt, Church, Cole oder Gifford sich ihren nagelneuen Kontinent zu eigen machte. Das spielt in die frühe Reisephotographie der Zeit, die dieselben Sujets aufgreift, der Malerei verschwistert ist, im Piktoralismus gar die Grenzen der Disziplinen absichtsvoll zum Verschwimmen zu bringen sucht. Denn nur der Ideologe beißt sich am je anderen Metier. Dem, der etwas ausdrücken will, sind die Mittel allein nach dem Maße wertig, wie sie seinem Ausdruckswollen zuträgliche sind. Malt doch das Kino heute mit digitaler Palette fremde Welten, sein es Herr der Ringe, Krieg der Sterne, Avatar, die uns berauschend fremde scheinen. Und doch vertraute sind. In all dem, was uns den Atem verschlagen will, nimmt uns das an die Hand, was wir wiedererkennen. All die Topoi, die unser Bildgedächnis formen. Wären sie in diesem Gebrause nicht vorhanden, ginge uns augenblicklich die Orientierung verloren.
Wem käme hier nicht Caspar David Friedrich in den Sinn, ist er doch Teil unsrer kollektiven Erinnerung geworden. Vielleicht ikonographisch überhaupt der Inbegriff von bewester Stille, von zwingend unleugbarer Präsens in der Einsamkeit zwischen uns und dem Horizont. Still sind Nathalie Grenzhaeusers Landschaftsräume. Ferne auch, Spitzbergen, Polarkreis. Dort erwartete man keine Geschäftigkeit, dort ginge man wohl eher in der Weite verloren, so wie es genügend kecken Polarexpeditionen ergangen ist. So scheint die Landschaft epische Weite. Leuchtkräftig in ihren Lichtspielen die einen, andere Studien in farbigem Weiß. Menschenleer. Nähert man sich ihnen allerdings, so mag man feststellen, dass die Vertreter unserer Art durchaus auch hier Spuren hinterlassen haben. Kein Naturraum ist zu unwirtlich, dass sich nicht für irgendjemanden seine Ausbeutung lohnte, seine zumindest zeitweise Inbesitznahme und Zersiedlung hinderte, keiner so schützenswert, dass sich nicht dennoch welche fänden, die darin ihren Abfall hinterließen. So atemberaubend schön ihre Bilder die Landschaft zelebrierten, so wenig erbaulich ist die Aussage, die sie über unsere Artgenossen, mithin letzten Endes auch über unsere Charaktereigenschaften treffen. Auf der anderen Seite gewinnen die menschlichen Zutaten in dieser Welt, die Maschinen und Behausungen in ihrer Pittoreskheit, auch in ihrem teils ruinösen Zustand erstaunliches Eigenleben, Individualität und Charakter. Beinahe schließlich, als wären sie selber Teil dieser Welt geworden, nicht Fremdkörper mehr, oder am Ende schon immer dort gewesen.
Aber das ist nur scheinbar. Denn auch die Bilder sind Schein. Was so real, was so echt wirkt, ist Täuschung. Zitiert auch sehr bewusst die kunstgeschichtliche Ikonographie, ohne aber damit zu renommieren. Denn obzwar die Photographien vor Ort entstanden, geben sie nicht wieder, was sie anscheinend vorgeben zu sein. Allesamt sind sie am Computer nachbearbeitet, in ihren Klängen gefiltert, in ihrer Elementen hintergründig verformt, ohne dass die Nähte jemals sichtbar würden. Was dort am Himmel kompositorische Entgegnung oder Entsprechung zu den Elemente am Boden in der glücklichen Fügung des Augenblicks gewesen sein möchte, ist Montage. Zweifellos und bei näherem Hinsehen als Bildfindung richtig, meteorologisch aber völlig unmöglich. Eine Wirklichkeit, überzeugender als die echte. Auf dem schmalen Grat, zwischen dem, was ist, und dem, was sein könnte, macht sie sichtbar.
Wir nehmen es staunend zur Kenntnis, als hätten wir es noch nie gesehen.
Streng genommen, haben wir das auch nicht.
22.I.2010
 Gerhard van der Grinten und Rainer Werner, gut drauf
|